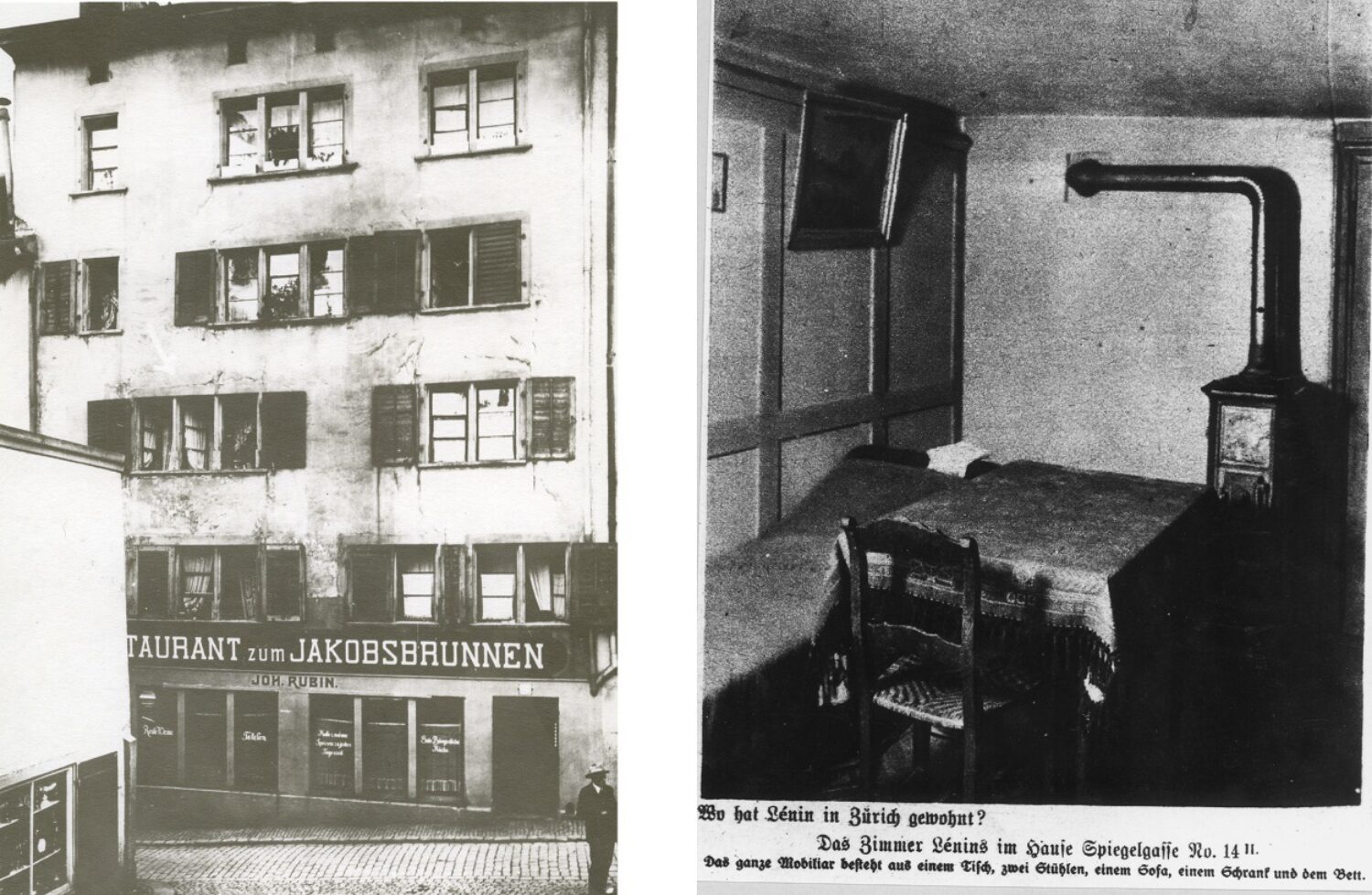Unter der Moderation von Helena Nyberg diskutieren Mareile Flitsch vom Völkerkundemuseum, Runa Löb vom NONAM und Willi Wottreng, der aus seinem Buch Deskaheh – Ein Irokese am Genfersee (2018) liest. Aus dem Buch der kürzlich verstorbenen Rea Brändle las Laura Huonker. Im Jahr 1832 sitzt der junge Charles Darwin an einem Strand auf Feuerland, will überall lieber sein als auf dieser Insel am Ende der Welt, und lässt seinen Frust an den Feuerländer*innen aus. Diese seien, so schreibt er in sein Notizbuch, hässlich und ausgesprochen dumm, die Geräusche, die sie von sich gäben, würden den Namen «Sprache» gar nicht verdienen, und Kannibalen seien sie auch. Die Schweizer Zeitungen nahmen Darwins Schilderungen nur allzu begierig auf und berichteten in verächtlichem Ton über die Menschen, die 1880 von Feuerland nach Zürich kamen.
Dort wurden die «Wilden» in sogenannten Völkerschauen dem faszinierten Publikum vorgeführt. Auf der Bühne sollten sie ein «authentisches» Dorfleben inszenieren; Waffen herstellen, Tänze aufführen, dem Publikum ihre Andersartigkeit eindrücklich präsentieren. Die kürzlich verstorbene Journalistin Rea Brändle rollt diese Ereignisse in ihrem Buch Wildfremd, hautnah. Völkerschauen und ihre Schauplätze, 1835 bis 1964 (2013) auf und beleuchtet kritisch die Rolle der Schweiz im Kontext dieser Völkerschauen, welche auch hierzulande auf immenses Interesse stiessen. Man wollte Exotik sehen, das Ursprüngliche, das Wilde. Oft wurde dabei nicht authentische Kultur gezeigt, sondern was die Europäer*innen glaubten, was indigene Kulturen ausmacht – und diese Vorstellungen beschränkten sich oft darauf, die «Indianer» und ihre Kultur seien den Europäern unterlegen.
Gleichzeitig stiessen die Menschen, die im Rahmen solcher «Völkerschauen» in die Schweiz kamen, aber auch auf grosse Bewunderung in der Bevölkerung. Der Zirkus Knie etwa stürzte das Land in ein wahres Wildwest- und Indianer-Fieber, als er 1931 «Indianer» als Attraktion auftreten liess.
Doch auch dieses idealisierte Bild der «Indianer», welches durch Autoren wie Karl May und seinen Helden Winnetou Eingang in die Populärkultur fand, ist problematisch. Mareile Flitsch vom Völkerkundemuseum gibt zu bedenken, wie schnell Bewunderung in Verklärung und Bevormundung umschlägt, wenn man Indigene zu «edlen Wilden» stilisiert und ihnen eine spirituelle Naturverbundenheit, dafür aber keinen kulturellen Fortschritt zuerkennt oder sie als besonders schützenswerte Kulturen sieht, ohne ihnen zuzugestehen, dass sie ihre Anliegen selber durchsetzen können.Gegen diese vielschichtig stereotypen Bilder, welche sich Europa von seiner Kultur gemacht hat, musste sich auch Levi General, besser unter seinem Titel «Deskaheh» bekannt, durchsetzen. Er reiste als Vertreter eines Bundes von sechs Irokesen-Nationen nach Europa, um für ihre Anerkennung als unabhängige Nation zu kämpfen. Er hielt in der gesamten Schweiz zahlreiche Vorträge und Reden, vor dem Völkerbund durfte er jedoch seine Anliegen nie vorbringen. Willi Wottreng hat Deskahehs Geschichte und vor allem seine Zeit in der Schweiz aufgearbeitet und zeichnet in seinem Buch das Bild eines Mannes, der sich unermüdlich für die Anerkennung und Gleichstellung seiner Kultur in den Augen der Europäer bemüht hat.Willi Wottreng hebt immer wieder hervor, dass es genauso ein Klischee sei, dass Indigene im Kontakt mit den Europäern immer nur Opfer waren. Er erinnert daran, dass einige von ihnen davon lebten, diese Klischees in Völkerschauen zu performen. So vermarkteten sie erfolgreich Produkte, welche die Europäer*innen als «typisch indianisch» wahrnahmen, und befriedigten besonders in der DDR das Bedürfnis der Menschen nach Spiritualität, wie Mareile Flitsch hinzufügt.
«Die Verhältnisse sind komplexer als ein einfaches Opfer-Täter-Schema. Wir müssen das anerkennen und die Indigenen als Akteur*innen in ihrer eigenen Geschichte wahrnehmen», fordert Wottreng, der beschreibt, wie auch Deskaheh geschickt mit Stereotypen spielte, um seine Interessen durchzusetzen. Deskaheh trug zu seinen Auftritten in Europa beispielsweise einen Federschmuck, wie er für seine Kultur überhaupt nicht traditionell ist, weil er wusste, dass er in diesem Aufzug mehr Aufmerksamkeit erregen konnte.
Stereotypen sind ohne Frage schädlich für die, welche von ihnen betroffen sind – sie können aber, richtig eingesetzt, auch ein Werkzeug sein. Auf diesem Grat wandelt auch das NONAM etwa mit seiner Dauerausstellung, die traditionelle Kleidung und Alltagsgegenstände aus verschiedenen indigenen Kulturen zeigt.
«Natürlich zeigen wir auch zeitgenössische indigene Kunst», sagt Runa Löb. «Aber die Besucher*innen kommen oft auch wegen des Exotischen zu uns ins Museum. Das gibt uns wiederum auch die Möglichkeit, diese Stereotypen aufzugreifen, mit ihnen zu arbeiten und sie schliesslich aufzubrechen.» Teil dieses Prozesses ist es, dass die Besucher*innen des NONAM ihre eigenen Stereotypen als solche erkennen und sich fragen sollen, wie diese entstanden sind. Diese Erkenntnis erlaubt nicht zuletzt einen entlarvenden Blick auf die eigene Kultur.
«Wir erfahren viel mehr über die Menschen, die Völkerschauen inszeniert haben, als über die, welche in ihnen ausgestellt wurden», sagt Runa Löb.
Bild: Sogenannte Indianer – leider ist die genaue Herkunft unbekannt – am Flughafen Kloten. 11.03.1958 Beat Jost © StAAG/RBA1-1-25255_1
Read more